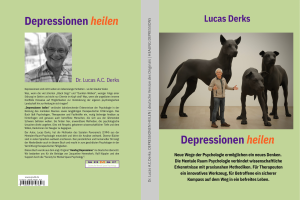NLP UND DAS META-MODELL DER SPRACHE
NLP und seine Weise, Sprache als Meta-Modell zu begreifen
Wir alle nutzen Sprache zur Gestaltung. Nur werden wir in der Regel nicht vollends verstanden. Was also tun? Wir geben hier im Weiteren einen guten Einblick in die Ursachen und auch Hinweise zur Optimierung. Das Meta-Modell der Sprache ist ein wichtiger Bestandteil des Kommunikationsmodells im NLP. Wahrnehmungsfilter spielen dabei eine wichtige Rolle. Die Bezeichnung Meta-Modell weist auf ein übersprachliches Wahrnehmen hin. Eine Art Selbstbeobachtung und ein Hinhören auf besondere Art und Weise. Wir nehmen uns hier im Folgenden den drei Kategorien an, die uns den Fokus auf die sogenannten Meta-Modell-Verletzungen geben.
- Generalisierung
- Tilgung
- Verzerrung
Im Bereich der sprachlichen Filter fällt eine Vielzahl spezifischer Einzelfälle in diese drei Rubriken, die wir im NLP beachten wollen.
Diese Einführung behandelt das grundsätzliche Verständnis der drei Filter und welche Bedeutung sie für uns im privaten und beruflichen Alltag haben.
Noch nie gehört – Die Tilgung im Meta-Modell der Sprache
Die Art unserer Informationsselektion geschieht größtenteils unbewusst und das kann sich in einigen Fällen nachteilig auswirken. In Problemzusammenhängen kann der Ausschluss von Erfahrungsanteilen eine Lösung blockieren. Eine genaue Hinterfragung ermöglicht dann eine Wiedergewinnung verlorener Informationen. Das bedeutet, eine vollständige Beschreibung des präsentierten Inhalts durch passende Fragen zu erhalten. Sprache sehen wir im NLP als einen machtvollen Informationsfilter.
Beispiele:
- „Man sollte ihm mal die Meinung sagen.“ -> „Wer sollte ihm die Meinung sagen?“
- „Ich habe Angst.“ -> „Vor wem oder was hast du Angst?“
- „Sie ärgerte mich.“ -> „Wie genau hat sie dich geärgert?“
- „Die haben Begeisterung verbreitet.“ -> „Wie genau haben die Begeisterung verbreitet?“
- „Die Angst lähmt mich.“ -> „Wer (was) ängstigt dich?“
- „Ich habe Hoffnung.“ -> „Worauf hoffst du?“
- „Ich will Hilfe.“ -> „Wie soll dir geholfen werden?“
Das ist doch immer so – Die Generalisierung im Meta-Modell der Sprache
Haben wir in einer konkreten Situation eine Erfahrung gemacht, neigen wir dazu, diese Erfahrung auf ähnliche Situationen zu übertragen. Dadurch lernen wir, in der Welt zu bestehen. Im NLP achten wir zum Beispiel auf Wörter wie alle, jene, absolut, niemand, jeder, sämtliche, irgendeiner, keiner, nie, nirgends, immer, niemals, man. Bei der Verwendung dieser Wörter generalisiert der Redner seine Erfahrung und schließt somit Wahlmöglichkeiten von vornherein aus.
- „Niemand hört mir zu.“ -> „Willst du damit sagen, dass dir niemand überhaupt jemals zuhört?“
-> „Das heißt, es gibt absolut niemanden, der dir jemals zuhört.“ - „Keiner glaubt mir.“ -> „Willst du damit sagen, dass dir absolut niemand glaubt?“
-> „Wirklich keiner?“ („Keiner“ verstärkt betont)
Darüber hinaus können Wörter unterschieden werden, die keine Wahlmöglichkeiten lassen. „Muss“, „kann nicht“, „notwendig“ und „sollte“ sind Beispiele dafür. Eine Hinterfragung an dieser Stelle ermöglicht es dem Gesprächspartner, über die bisherigen Grenzen hinauszugehen. Gleichzeitig geht der Partner dabei in die Zukunft und setzt sich mit möglichen Konsequenzen auseinander.
- „Ich kann’s nicht machen.“ -> „Was würde passieren, wenn du es machen würdest?“
- „Man muss das so machen.“ -> „Was hindert dich daran, es anders zu machen?“
Unglaublich anstrengend – Die Verzerrung im Meta-Modell der Sprache
Verzerrungen werden negativ, wenn sie die eigene Lebensqualität einschränken. Wenn zum Beispiel jemand auf Kritik mit „Ich bin nicht liebenswert“ reagiert, ist dies eine Verzerrung, die jegliches Lernen und die Möglichkeit der Veränderung ausschließt. Durch die Arbeit mit Verzerrungen erlangt eine Person eine viel reichhaltigere Wahlmöglichkeit und Handlungsfähigkeit. Dadurch kann die Person so handeln, wie sie sonst handeln würde, ohne irgendwelche Einschränkungen. Eine Verzerrung besteht zum einen darin, dass in der Vorstellung von A Ursache und Wirkung vertauscht oder falsch zugeordnet werden. Das Hinterfragen von Ursache und Wirkung stellt die getroffene Annahme in Zweifel. Der Gesprächspartner beginnt zu untersuchen, ob diese geknüpfte Verbindung tatsächlich vorliegt.
„Toms Handeln verursacht meine Bauchschmerzen.“ -> „Wie verursacht Toms Handeln, dass du Bauchschmerzen bekommst?“
Toms Handeln wird direkt mit den Bauchschmerzen von A in Verbindung gebracht. Gleichzeitig schiebt A die Verantwortung für die Bauchschmerzen Tom zu und nimmt sich dadurch selbst die Möglichkeit, etwas zu tun, um das eigene Erleben zu verändern. Ein Prozess, bei dem man fehlende Informationen durch Annahmen, Interpretationen und falsche Schlüsse ersetzt, wird Gedankenlesen genannt. Genaues Nachfragen hat den Vorteil, sich der Annahmen, die bisher vielleicht als selbstverständlich galten, bewusst zu werden und gegebenenfalls zu korrigieren.
- „Alle meinen, ich bin verrückt.“ -> „Woher weißt du, dass alle meinen, dass du verrückt bist?“
- „Ich weiß, dass er mich nicht liebt.“ -> „Woher genau weißt du, dass er dich nicht liebt?“
- „Das ist genau richtig für ihn.“ -> „Woher weißt du denn, dass das genau das Richtige für ihn ist?“
Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, hier geht es zum Training hin zum Spezialisten und in die Tiefe.