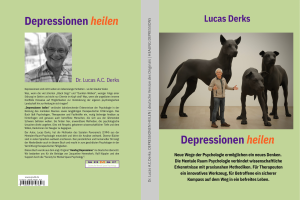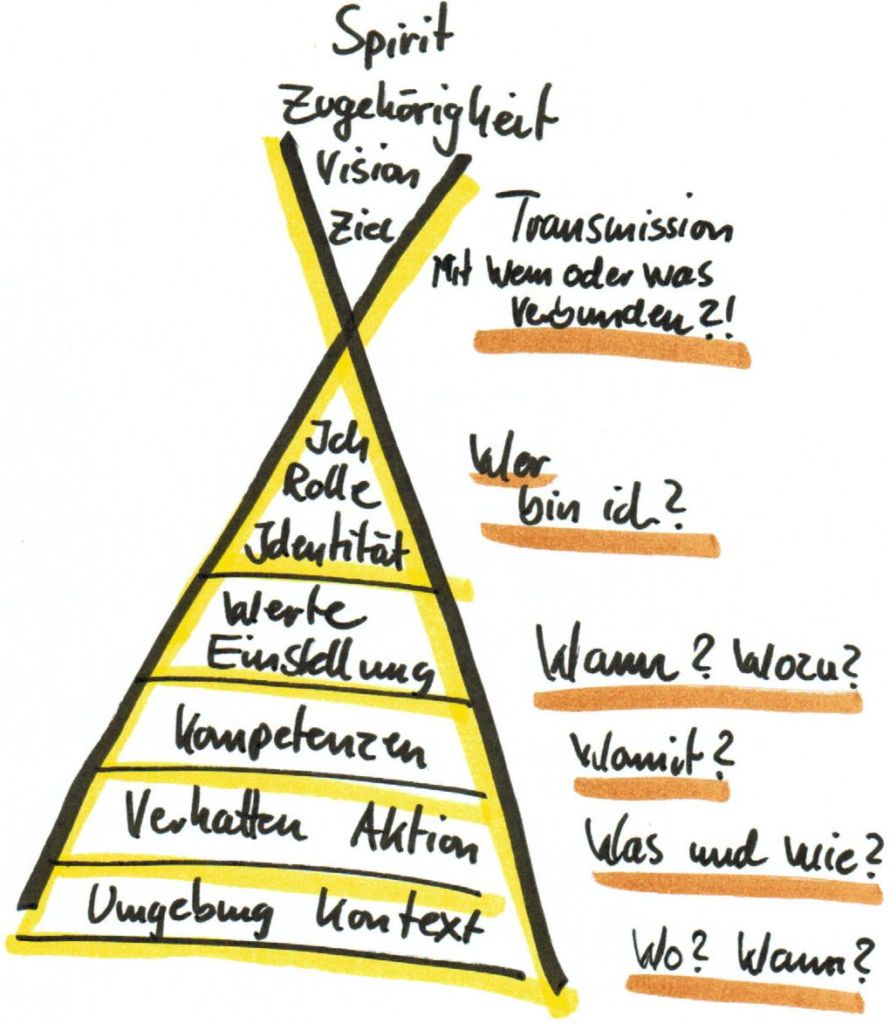
DER BILLIGBAUMARKT DER ALLTAGSSPRACHE
Provokant, ABER genauso gemeint | Wir bedienen uns oft im Billigbaumarkt der Alltagssprache
Sprachliche Herausforderungen zeigen sich gerne auch im Alltäglichen. Wir nennen das bei nlpsachsen den Billigbaumarkt der Alltagssprache. Beispiele: Jedes „Ja, aber …“ zeigt, dass Sie etwas an den Aussagen Ihres Gegenübers nicht gut finden, ergänzen oder richtigstellen müssen. Sie stimmen nicht wirklich zu, oder? Vielmehr zeigen Sie den Anderen, dass sie nicht richtig liegen oder Dinge nicht bedacht haben. Ihre Zuhörer geraten dabei oft in Rechtfertigungsdruck. Statt der lösungsorientierten Auseinandersetzung entwickelt sich oft ein als so wahrgenommenes Streitgespräch. Dass sich so ein Schlagabtausch entwickelt, liegt oft auch daran, dass Sie Menschen keine Möglichkeit geben, alle Ideen bis zum Ende anzubieten. Wir platzen oft und spontan mit unseren Einwänden herein. Im Nachfolgenden führen wir Sie durch die weiteren Abteilungen eben dieses Billigbaumarktes der Alltagssprache.
Hier stellen wir ihn vor, den Billigbaumarkt der Alltagssprache:
»Ja, aber«
Hier wird nicht nur ein eventuell wertvoller Beitrag komplett negiert, es wird außerdem noch der Sprecher auf diffizile Weise diffamiert. Meist geht noch die Stimme hoch und klingt so richtig rechthaberisch.
- Der freundliche und kooperative Weg lautet: „Ja und…“.
- Wenn der Beitrag etwas inhaltlich Gutes enthielt: »Ja, das ist gut, und darüber hinaus …«.
- Wenn der Beitrag etwas inhaltlich neutral war: »Ja, und meine Meinung dazu ist …«
- Wenn der Beitrag inhaltlich Schlechtes enthielt: »Ja, nur dazu möchte …«
»eigentlich«
Dieses im Grunde sehr „kostbare“ Wort zeigt eine Inkongruenz an. Das bedeutet, dass die Aussage, in der ein »eigentlich« vorkommt, nicht hundertprozentig die Meinung des Sprechers widerspiegelt.
- »Eigentlich gefällt mir der Beitrag sehr gut.“
- Falsch: »Was gefällt dir daran nicht?«
- Richtig: »Was könnte denn an dem Beitrag geändert werden, damit er dir noch besser gefällt?«
»man«
»Man« wird mit Vorliebe anstelle von »ich«, »du«, »ihr« und »wir« eingesetzt. Insofern ist es ein Wort von hoher Universalität und genau darin liegt die Gefahr. Häufig kommt es nämlich darauf an, zu wissen ob »ich«, »du«, »wir« oder »ihr« etwas getan haben. Und genauso häufig, wenn es gilt, irgendetwas zu machen, zu arbeiten oder zu verantworten, dann ist immer ein mysteriöser »man« an vorderster Front. Am besten fragen: „Wer genau?“ Man sollte »man« nicht generell verurteilen. Hin und wieder ist es auch angebracht. Immer dann, wenn tatsächlich kein genauer Adressat zuzuordnen ist oder wenn kein Adressat zugeordnet werden soll. Allerdings ist dies relativ selten der Fall.
»Warum«
Warum ist ein Fragewort, welches besonders bei Kindern sehr beliebt ist. Erwachsene sollten es daher auch den kleinen Erdenbürgern überlassen. Warum? Darum! Mit »Warum« wird immer auch ein wenig die Persönlichkeit des Befragten angegriffen. Zum Beispiel:
- »Warum hast du die Zahnpastatube schon wieder nicht zugedreht? (Du blöde Kuh!)«
- »Weil Du letztens den Klodeckel nicht zugemacht hast!«
- »Und Du hast letztens die Toilette total dreckig hinterlassen!«
- »Ja, aber du lässt das Licht immer an!«
Eine Fehlkommunikation, die schnell zur Scheidung führt. Die bessere Frage lautet: »Wie kommt es, dass …?« und nie »Warum?« »Warum kommen Sie schon wieder zu spät?« impliziert ebenfalls einen Bummelanten und wird höchstens die Fantasie im Ausreden erfinden trainieren. Auch hier lautet die bessere Frage: »Wie kommt es, dass Sie so spät dran sind? Kann ich irgendwas tun, um Ihnen zu helfen?«. Die Absicht ist ja, dass die Person zeitiger kommt. Weniger interessant ist, wo sie war — vor allem weniger hilfreich. »Warum« führt in die falsche Richtung, sucht nach Schuldigen und verhindert Lösungen.
»nicht«
Menschen ist es schwer möglich, in Negationen zu denken! Lesen Sie jetzt nicht weiter. So, Sie haben weiter gelesen – bedenklich, bedenklich. Bewegen Sie sich gerade im Billigbaumarkt der Alltagssprache? Hören Sie jetzt bitte nicht auf die Geräusche in Ihrer Umgebung. Fühlen Sie jetzt bitte nicht, wie kalt oder warm Ihre Füße sind. Zeigt mir den, der nicht eben seine Löffel aufsperrte und der mir jetzt nicht sagen kann, wie es seinen Füßen geht.
- »Ich will das jetzt nicht!«
- Falsch: »Warum?«
- Richtig: »Was möchtest Du stattdessen?«
- Falsch: »Nicht so schnell!«
- Richtig: »Etwas langsamer bitte.«
Vermeide ein »nicht« und verwende stattdessen immer positive Formulierungen.
»Killerphrasen«
Killerphrasen sollen den Empfänger in Erklärungsnöte bringen und ihn dumm dastehen lassen. Abgesehen davon, dass Killerphrasen meistens eine Abwertung des Empfängers durch den Sender sind, kommen Sie zudem für den Empfänger oft überraschend.
- „Dafür ist jetzt keine Zeit.“
- „Bin ich Jesus?“
- „Rede mit dem Fisch.“
- „Wer ist Ihr Vorgesetzter?“
- „Das ist zu teuer.“
- „Das haben wir schon immer so gemacht.“
- „Kinderkram.“
- „Dafür werde ich nicht bezahlt.“
- „Entspann dich!“
Diese kurzen und prägnanten, durch Ironie, Sarkasmus oder Zynismus noch »witzig« eingefärbten Statements gehen von der Sachebene auf die persönliche Ebene. Im Regelfall schießt das Opfer dann auch noch mit gleichem Kaliber zurück, mit dem Ergebnis, dass der eigentlich sachliche Kern nun garantiert verloren ist. Welche Möglichkeiten gibt es zum Entschärfen von Killerphrasen?
Rapport herstellen:
- Ich-Botschaften mit Gefühlen senden
- Anerkennen von Positivem
- Ansprache im Rahmen einer persönlichen Beziehung
- Rollentausch anregen
- Persönliche Beziehung herstellen
- Fragen statt Statements
- Pacen und Leaden — erst mal schimpfen lassen, damit man erfährt, was dem anderen wichtig ist und danach darauf eingehen
Vielleicht haben Sie Lust, sich dahingehend und für noch viel mehr zu interessieren – Hier Ihr Weg dazu.