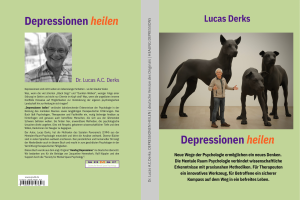KLEIDER MACHEN LEUTE (INTELLIGENT)
Wie wirkt Kleidung, die wir tragen, auf uns selbst?
Nimmt es Einfluss auf die Qualität unserer Arbeit, wenn wir im Schlafanzug im Homeoffice arbeiten?
Ich hatte schon vor einigen Jahren, das Vergnügen einen Impulsvortrag zu diesem Thema für eine Unternehmen zu halten. Ein Unternehmen, das mit Callcenteragents den Erfolg für seine Kunden einfährt. Mit dem Unterschied zu vielen Konkurenten (damals), das die Mitarbeiter von Zuhause aus arbeiten. Das Problem, einige der Mitarbeiter kleideten sich nicht wie im Handbuch festgelegt wurde. Die einfache Forderung war: „Kleiden Sie sich bitte zum Telefonieren so, wie Sie beim Kunden auftreten würden, wenn Sie das konkrete Produkt vor Ort vorstellen würden.“ Die Vermutung war, das Erfolge einzelner Kollegen, auch mit auf dem Einfluss der Kleidungswahl fussen könnte. Bei meiner Vorbereitung stieß ich auf die folgende Studie:
Kleidung wirkt psychologisch auf uns.
Unsere Kleidung wirkt sich nicht nur auf andere aus, sondern auch auf uns selbst – und zwar auf ziemlich verblüffende Weise. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest der renommierte Psychologe Adam Galinsky von der Northwestern Universität in einer neuen Studie, die er gemeinsam mit seinem deutschen Gastforscher Hajo Adam erarbeitete. Untersuchung trägt den Namen „Enclothed cognition“, was frei übersetzt so viel bedeutet wie „angezogene Wahrnehmung“. Ein Hinweis darauf, dass Kleidung im Zentrum der Studie stand. Genauer gesagt: weiße Laborkittel – das typische Accessoire jedes Arztes und Wissenschaftlers.
Diese Berufsgruppen genießen gemeinhin den Ruf, achtsam und sorgfältig zu sein. Und die Studie zeigt: Dieses Klischee wirkt sich auch unmittelbar auf die Träger eines Kittels aus. Damit Sie die Experimente, die ich gleich beschreibe, besser nachvollziehen können, hier ein kurzer Test. Lesen Sie bitte laut und deutlich folgende Wörter vor:
Rot Grau Blau Grün Schwarz
Okay, das war ziemlich leicht.
Nun zur nächsten Aufgabe. Sprechen Sie jetzt bitte die Farbe aus, in der die Wörter geschrieben sind:
Rot Grau Blau Grün Schwarz
Schon schwieriger, oder?
Kommen wir zum letzten Teil. Sprechen Sie einfach wieder die Farbe aus, in der die Wörter geschrieben sind:
Rot Grau Blau Weiß Schwarz
Lassen Sie mich raten: Jetzt haben Sie noch länger gebraucht oder sind gar ins Stottern gekommen?
Verblüffende Wirkung
Letztlich liegt das an einer Sinnesüberreizung und einem Widerspruch der Hirnaktivitäten. Das Lesen einfacher Worte wie „Rot“ oder „Schwarz“ ist ein automatischer Akt, den wir kaum unterdrücken können. Das Erkennen und Nennen von Farben dagegen erfordert unsere willentliche Konzentration und Analyse. Erst recht dann, wenn die eigentliche Farbe und das Wort unterschiedlich sind. Dann kommt es zu erheblichen Verzögerungen – dem so genannten Stroop-Effekt, der seinen Namen dem US-Psychologen John Ridley Stroop verdankt. Die Übung wird heute auch als „Stroop-Test“ bezeichnet. Und das führt uns zurück zur Studie Galinsky und Adam.
In ihrem ersten Experiment reichten die beiden Wissenschaftler der einen Hälfte der 58 Probanden einen Kittel, der andere nicht. Nun sollten alle den Stroop-Test absolvieren und so schnell wie möglich sagen, welche Farbe bestimmte Wörter hatten. Mal entsprach diese Farbe der Bedeutung des Worts („rot„), mal war sie unterschiedlich („rot„).
Kaum zu glauben, aber wahr: Der Kittel wirkte sich erheblich auf die Leistungsfähigkeit aus. Die Teilnehmer mit Kittel machten bei den schwierigen Durchgängen („rot„) gerade mal halb so viele Fehler wie jene Teilnehmer ohne Kittel! Ein Indiz darauf, dass alleine das Tragen des Kittels die Aufmerksamkeit verbesserte.
Dieser Verdacht erhärtete sich in den weiteren Versuchen. Bei einem davon sollten die Probanden auf zwei fast identische Fotos schauen und die vier kleinen Unterschiede zwischen den Bildern finden. Vorab wurden sie in drei Gruppen geteilt: Gruppe A ging davon aus, einen Arztkittel zu tragen. Gruppe B wurde suggeriert, dass es sich dabei um den Kittel eines Malers handelte. Gruppe C behielt zwar ihre normalen Klamotten an, sollte aber vor dem Stroop-Test einen kurzen Aufsatz darüber schreiben, was sie mit dem Kittel eines Arztes verbinden.
Und siehe da: Wieder schlugen sich jene Teilnehmer am besten, die einen Kittel trugen. Doch noch verblüffender: Gruppe C erzielte bessere Resultate als Gruppe B. Offenbar sorgte die geistige Auseinandersetzung mit einem Arzt oder Wissenschaftler dafür, die Sinne buchstäblich zu schärfen.
Was war hier los? Zauberei? Mitnichten. Eher setze das Tragen bestimmter Kleidung entsprechende Assoziationen frei, resümieren die Wissenschaftler. Und weil wir mit dem Doktorkittel üblicherweise Sorgfalt und Achtsamkeit in Verbindung setzen, überträgt sich dieser Gedanke auch auf unser eigenes Verhalten: Wir werden selbst sorgfältiger und achtsamer. Kleider machen eben Leute – sogar intelligent(er).
Ich wünsche Ihnen und Euch wieder
Feel Erfolg
Grüße, Ihr und Euer Ralf
Quelle: Hajo Adam und Adam D. Galinsky (in press). Enclothed Cognition. In: Journal of Experimental Social Psychology.